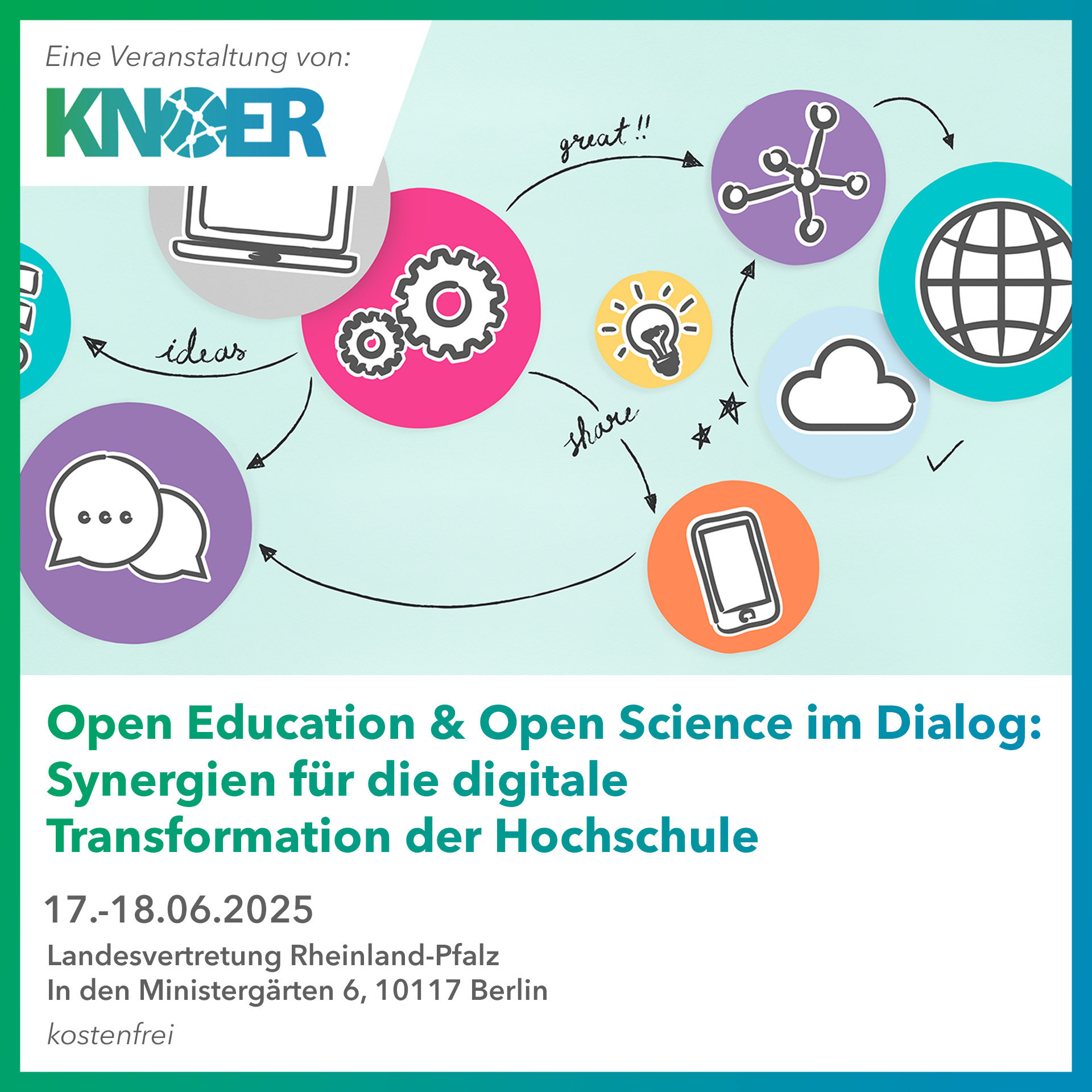Vom 16. bis 17. Juni 2025 fand in Berlin die diesjährige KNOER-Jahrestagung statt. Nach einem erfolgreichen Auftakt des Veranstaltungsformats vor einem Jahr in Tübingen konnte die diesjährige Ausgabe der Tagung in Berlin erneut überzeugen. Im Anschluss an die Tagung trafen sich die KNOER-Mitglieder sowie Vertreter:innen der jeweiligen Landesministerien zur KNOER-Mitgliederversammlung, bei der auch das neueste KNOER-Mitglied offiziell begrüßt wurde.
KNOER-Jahrestagung Vol. 2
Schon zum zweiten Mal richtete das Kooperationsnetzwerk OER-förderliche Infrastrukturen und -dienste (#KNOER) seine Jahrestagung nun aus. Nach dem erfolgreichen Auftakt in Tübingen im Jahr 2024 fanden in diesem Jahr etwa 80 Teilnehmende den Weg nach Berlin, um gemeinsam die Schnittstelle von Open Education und Open Science genauer in den Blick zu nehmen. Ziel war es, die Potenziale und Synergien zu nutzen, die sich aus einer engeren Zusammenarbeit der jeweiligen Akteur:innen ergeben. Als Veranstaltungsort fungierte im Herzen des politischen Berlin die Landesvertretung von Rheinland-Pfalz.



Ein starker Einstieg
Den inhaltlichen Auftakt der Tagung gestaltete Prof. Dr. Michael Jäckel (Universität Trier, Leitungsgremium des VCRP) mit seinem Impuls „Catch all“ – Ein Leitbild für Open Science und KI? Er behandelte den tiefgreifenden Wandel von Bildung, Wissen und akademischer Praxis im digitalen Zeitalter. Dabei thematisierte er insbesondere das Spannungsfeld zwischen Individualität, Offenheit, maschinellem Lernen und gesellschaftlichem Vertrauen. Historische und aktuelle Perspektiven zeigten, wie sich Erwartungen und Bedingungen des Wissenserwerbs und der Wissensvermittlung durch technologische und kulturelle Dynamiken verschieben. Die Reflexion mündete in Thesen zur Bedeutung von Offenheit, Metadaten, individueller Leistung und dem neuen Verhältnis von Mensch und KI in Wissenschaft und Bildung.
Die Aufzeichnung des Impules von Prof. Dr. Jäckel finden Sie hier.
Die dazugehörige schriftliche Ausarbeitung des Impulses „Catch all“ – Ein Leitbild für Open Science und KI? finden Sie hier.
Spannend ging es danach weiter mit dem ersten Teil einer Doppel-Keynote – gehalten von Prof. Dr. Ellen Euler (Fachhochschule Potsdam). Sie plädierte dafür, Open Education und Open Science als Teil eines übergreifenden Metathemas „Offenheit“ zu verstehen und gemeinsam zu gestalten. Offenheit erfordere strukturelle, kulturelle und politische Anstrengungen, um eine zukunftsfähige, gerechte Wissensgesellschaft zu ermöglichen. Dabei betonte sie die Bedeutung von Vernetzung, gemeinsamen Standards und nachhaltiger Finanzierung sowie die Chancen und Herausforderungen durch KI. Offenheit sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die interdisziplinär und institutionell koordiniert werden müsse – denn „die Zukunft ist offen, aber nicht von allein.“
Die Aufzeichnung der Keynote von Prof. Dr. Euler finden Sie hier.
Der zweite Teil der Doppel-Keynote wurde von Prof. Dr. Christof Schöch (Universität Trier) gestaltet. Unter dem Titel „Open Science und Open Education aus der Perspektive der Digital Humanities“ zeigte er, dass Offenheit in den Digital Humanities ein zentrales Prinzip ist, das Forschung, Lehre und Infrastruktur eng miteinander verbindet. Open Science und Open Education würden hier nicht als getrennte Bereiche verstanden, sondern als zwei Seiten derselben offenen wissenschaftlichen Praxis. Schöch illustrierte dies anhand konkreter Beispiele wie der hohen Open-Access-Quote bei Zeitschriften und digitalen Editionen sowie der engen Verzahnung von offenen Forschungsdaten, Methoden und OER. Angesichts der wachsenden Bedeutung generativer KI betonte er die Notwendigkeit, die Offenheitskultur weiterzuentwickeln – etwa durch die Förderung offener Infrastrukturen, die gezielte Entwicklung von OER und einen reflektierten Umgang mit neuen Technologien.
Die Aufzeichnung der Keynote von Prof. Dr. Schöch finden Sie hier.



Interaktive Formate: Sechs Workshops
Im Rahmen der diesjährigen KNOER-Tagung wurden insgesamt sechs Workshops angeboten.
Im Workshop Offene Software als Basis für die Öffnung von Lehre und Forschung mit Christian Friedrich (Open Source Development Network) und Steffen Rörtgen (FWU Institut für Film und Bild gGmbH) wurde die Rolle von Open-Source-Software als Voraussetzung für offene Bildungs- und Forschungsprozesse diskutiert. Die Workshopleitenden warfen die Frage auf, ob echte Offenheit ohne offene Software überhaupt denkbar ist. Im Zentrum stand die Reflexion über die oft zitierte Nutzerfreundlichkeit proprietärer Tools gegenüber Open-Source-Alternativen – und die Frage, wie Letztere weiterentwickelt werden können, um nachhaltiger und zugänglicher zu werden.
Bonny Brandenburger (Europa-Universität Viadrina Frankfurt), Sascha Eckhold (Universitätsbibliothek, Freie Universität Berlin) und Dr. Ronny Röwert (Digital Learning Campus SH) gestalteten den Workshop Jenseits von Idealismus: Praktische Nutzung von Open Education und Open Science für Lehre und Forschung. Hier wurde der Fokus auf realistische und umsetzbare Strategien gelegt, mit denen Offenheit jenseits idealistischer Motivation etabliert werden kann. Mithilfe der TRIZ-Methode entwickelten die Teilnehmenden konkrete Maßnahmen zur Förderung offener Wissenschaft und Lehre und diskutierten, wie Openness nachhaltig in Hochschulstrukturen verankert werden kann.
Im Workshop Künstliche Intelligenz und Metadaten beschäftigten sich Katharina Trostorff (AG Didaktische Metadaten), Manuel Kummerländer (edu-sharing.net e.V.) und Constanze Reder-Knerr (VCRP) mit der Rolle von KI bei der Erzeugung und Qualitätsbewertung von Metadaten für offene Bildungs- und Forschungsinhalte. Nach einer Reflexion über die Bedeutung von Metadaten konnten die Teilnehmenden in kleinen Gruppen verschiedene KI-Tools praktisch erproben. Ziel war es, herauszufinden, wie künstliche Intelligenz dabei unterstützen kann, Materialien besser auffindbar und nutzbar zu machen.
Am darauffolgenden Tag bot der Workshop Open Education als University Citizenship mit Paulina Rinne (HessenHub), Marc Göcks (MMKH) und Konrad Faber (VCRP) eine grundlegende Auseinandersetzung mit der politischen Dimension offener Bildung. Im Mittelpunkt standen Fragen nach der Rolle von Hochschulen in gesellschaftlichen Transformationsprozessen, der Bedeutung von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz für demokratische Bildung sowie den Potenzialen einer offenen Wissenschaft als Beitrag zur Demokratiebildung. Im zweiten Teil des Workshops arbeiteten die Teilnehmenden aktiv an Handlungsfeldern zur Förderung einer demokratiefördernden offenen Hochschulbildung.
Einen fachlich orientierten Zugang verfolgten Dr. Christin Barbarino (Europa-Universität Viadrina) und Tanja Jeschke (BTU Cottbus Senfternberg) im Workshop Fach-Community-Arbeit in Open Science und Open Education. Ausgehend von den Erfahrungen des Projekts Co-WOERK diskutierten die Teilnehmenden, welche Strukturen Fachgesellschaften brauchen, um Openness wirkungsvoll zu fördern. Ziel war es, Potenziale, aber auch Grenzen der Fach-Community-Arbeit sichtbar zu machen – und zu zeigen, wie offene Praktiken in Forschung und Lehre mit fachlichen Besonderheiten in Einklang gebracht werden können.
Peter Salden (Zentrum für Wissenschaftsdidaktik, RUB) und Alexander Klein (ZOERR) widmeten sich im Workshop Implikationen des KI-Papiers der Wissenschaftsministerin für Open Education und Open Science den politischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI an Hochschulen. Gemeinsam mit den Teilnehmenden analysierten sie drei zentrale Positionspapiere – eines der Wissenschaftsministerkonferenz, ein weiteres vom Netzwerk der Landeseinrichtungen für digitale Hochschullehre (NEL) sowie ein drittes vom Stifterverband – und diskutierten, welche Forderungen formuliert werden, wie diese zusammenpassen und was aus Sicht einer offenen Bildungslandschaft ergänzt werden sollte.



Viele Meinungen und Perspektiven: Podiumsdiskussion und Fishbowl-Diskussion
Neben den Workshops bereicherten auch zwei Diskussionsformate die KNOER-Tagung 2025. Die Podiumsdiskussion bot Raum für einen vertieften Austausch zwischen ausgewiesenen Expert:innen. So diskutierten Heike Gleibs (Wikimedia Deutschland), Dr. Stefan Skupien (Berlin University Alliance), Lambert Heller (TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek) und Steffen Rörtgen (FWU Institut für Film und Bild gGmbH) die bildungspolitische Relevanz von Open Education und Open Science und die Frage, wie Offenheit in Lehre und Forschung nachhaltig gestaltet und gefördert werden kann.
Die Aufzeichnung der Podiumsdiskussion finden Sie hier.
Ergänzend dazu fand eine Fishbowl-Diskussion statt, bei der durch ihre offene und partizipative Struktur alle Anwesenden aktiv eingebunden wurden. Im Fokus hierbei: Open Education und Open Science im Zeitalter von generativer KI.


Mitgliederversammlung
Im Anschluss an die Tagung fand die Mitgliederversammlung des KNOER statt. Herzlich wurde dabei der neueste Teil des Netzwerks begrüßt: eSALSA, die eService-Agentur für die Hochschulen im Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch Dr. Michael Gerth. Damit umfasst das KNOER-Netzwerk mittlerweile mandatierte Einrichtungen aus insgesamt 10 Bundesländern.
Mitglieder
Das KNOER besteht Stand Juni 2025 aus den Mitgliedsorganisationen: ORCA.nrw | Das Landesportal für Studium und Lehre, Virtueller Campus Rheinland-Pfalz (VCRP), Zentrales Open Educational Resources Repositorium der Hochschulen in Baden-Württemberg (ZOERR), Multimedia Kontor Hamburg gGmbH (MMKH), Digital Learning Campus, twillo – Portal für Open Educational Resources (OER) in der Hochschullehre, eTeach-Netzwerk Thüringen, Bildungsportal Sachsen, HessenHub – Netzwerk digitale Hochschullehre Hessen, eSALSA, die eService-Agentur für die Hochschulen in Sachsen-Anhalt.
Workshop-Dokumentationen und Vortragsfolien
An dieser Stelle veröffentlichen wir die Präsentationen und Workshop-Ergebnisse der Tagung, zum Teil unter offener Lizenz:
Tag 1 (16.06.2025):
Präsentationsfolien der Tagungsmoderation (für beide Tage) von Prof. Dr. Konrad Faber und PD Dr. Markus Deimann
Hier finden Sie die Vortragsfolien zum Impulsbeitrag von Prof. Dr. Michael Jäckel, (Universität Trier und Sprecher des VCRP Leitungsgremiums) zum Thema “„Catch all“ – Ein Leitbild für Open Science und KI?”
Die Aufzeichnung des lmpulsbeitrags finden Sie hier.
Hier finden Sie die Vortragsfolien aus der Doppel-Keynote:
Präsentationsfolien zur Keynote von Prof. Dr. Ellen Euler (Fachhochschule Potsdam): „Offenheit gemeinsam gestalten: Open Science und Open Education als Verbündete der digitalen Hochschultransformation“
Die Aufzeichnung der Keynote von Prof. Dr. Euler finden Sie hier.
Präsentationsfolien zur Keynote von Prof. Dr. Christof Schöch (Universität Trier): „Open Science und Open Education aus der Perspektive der Digital Humanities“
Die Aufzeichnung der Keynote von Prof. Dr. Schöch finden Sie hier.
Präsentationsfolien zum Workshop von Christian Friedrich (Open Source Development Network) und Steffen Rörtgen (FWU Institut für Film und Bild gGmbH) zu „Offene Software als Basis für die Öffnung von Lehre und Forschung“
Workshop von Bonny Brandenburger (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)), Sascha Eckhold (Universitätsbibliothek, Freie Universität Berlin) und Dr. Ronny Röwert (Digital Learning Campus SH) zu „Jenseits von Idealismus: Praktische Nutzung von Open Education und Open Science für Lehre und Forschung“
Präsentationsfolien zum Workshop von Katharina Trostorff (AG Didaktische Metadaten), Manuel Kummerländer (edu-sharing.net e.V.), Constanze Reder-Knerr (VCRP) zu „Künstliche Intelligenz und Metadaten“
Tag 2 (17.06.2025)
Präsentationsfolien zum Workshop von Paulina Rinne (Hessenhub), Dr. Marc Göcks (MMKH) und Prof. Dr. Konrad Faber (VCRP) zu „Open Education als University Citizenship“ (vorläufige Version)
Präsentationsfolien zum Workshop von Dr. Christin Barbarino (Projekt Co-WOERK, Europa-Universität Viadrina)und Tanja Jeschke (Projekt Co-WOERK, BTU Cottbus Senfternberg) zu „Fach-Community-Arbeit in Open Science und Open Education“
Präsentationsfolien zum Workshop von Alexander Klein (ZOERR) und Peter Salden (Zentrum für Wissenschaftsdidaktik, Ruhr-Universität Bochum) zu „Implikationen des KI-Papiers der Wissenschaftministerien für Open Education und Open Science“
OER Hinweise
OER können vielseitig vervielfältigt, verwendet, verarbeitet, vermischt und verbreitet werden. Um rechtliche Fragen zum Beispiel zum Urheberrecht, Datenschutz und Prüfungsrecht zu beantworten, bieten die Landesinitiativen eine Reihe sich ergänzender Anlaufstellen und Tools. Bei ORCA.nrw ist dies beispielsweise die Rechtsinformationsstelle, bei twillo der Kompetenzbereich Rechtsfragen. Die HOOU bietet das Tool des Rechtslotsen, um sich über rechtliche Aspekte zu informieren. Darüber hinaus steht über das Multimedia Kontor Hamburg (MMKH) eine hochschulübergreifende Rechtsinformationsstelle im Rahmen der HOOU zur Verfügung, über die auch der Blog “HOOU-Rights” zu urheberrechtlichen Fragestellungen und CC-Lizenzen betrieben wird.